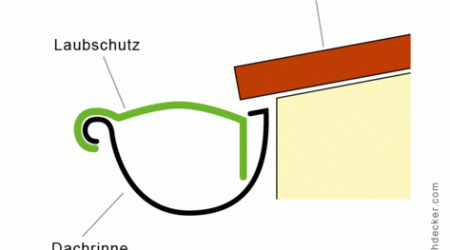In ländlichen wie auch in städtischen Gebieten besteht stets das Risiko eines Blitzeinschlags, der erhebliche Schäden an Gebäuden und elektronischen Geräten verursachen kann. Um sich vor diesen Gefahren zu schützen, ist die Montage eines Blitzableiters eine sinnvolle Maßnahme, die nicht nur Ihr Haus, sondern auch das Menschenleben schützt.
- Überblick: Blitzableiter Kosten
- Welche Aufgabe hat ein Blitzableiter?
- Wie funktioniert ein Blitzableiter?
- Ist ein Blitzableiter Pflicht?
- Darf ich einen Blitzableiter selbst installieren?
- Was kostet es, einen Blitzableiter zu installieren?
- Was kostet ein Blitzableiter?
- Installationskosten Blitzableitersystem
- Wie hoch sind die laufenden Kosten eines Blitzableiters?
- Vorteile und Nachteile eines Blitzableitersystems
- Diese fünf Dinge sollten Sie beachten
- Fazit
- Blitzableiter installieren: Häufig gestellte Fragen
Alles auf einen Blick:
- Blitzeinschläge an Gebäuden können strukturelle Schäden verursachen, Brände auslösen, elektrische Systeme beeinträchtigen und sogar Personen gefährden.
- Die Installationskosten einer Blitzschutzanlage liegen zwischen 3.000 und 7.000 Euro und hängen von verschiedenen Faktoren wie Gebäudegröße und Anlagenart ab.
- In manchen Fällen ist die Installation verpflichtend und in diesem Fall muss die Montage am besten einem Fachbetrieb überlassen werden.
- Regelmäßige Wartung und Inspektion sind notwendig, um die Schutzfunktion langfristig zu gewährleisten.
Überblick: Blitzableiter Kosten
| Kostenfaktor | Preis |
| Anschaffung und Installation | 3.000 und 7.000 Euro |
| laufende Wartungskosten | 150 bis 300 Euro pro Jahr |
Die Preise können aufgrund der unterschiedlichen Faktoren höher oder niedriger ausfallen. Möchten Sie Ihr Dach mit einer Blitzschutzanlage ausrüsten, kann Ihnen ein Fachbetrieb ein genaues Angebot erstellen.
Welche Aufgabe hat ein Blitzableiter?
Er trägt dazu bei, den Blitzstrom sicher in den Boden abzuleiten, um Schäden an der Gebäudestruktur und dem elektrischen Inventar zu vermeiden. Ohne diese Schutzmaßnahme kann ein direkter Blitzeinschlag Überspannungsschäden verursachen. Das kann nicht nur zu Sachschäden führen, sondern auch eine Gefahr für die Bewohner darstellen. Haben Sie Ihr Dach mit einer PV-Anlage ausgestattet, ist ein sogenannter Überspannungsschutz gemäß der DIN VDE-Normen sogar gesetzlich verpflichtend.
Worin liegt der Unterschied zwischen Blitzableiter und Blitzschutz?
Planen Sie die Montage einer Blitzschutzanlage treffen Sie auf zwei Begriffe: Blitzableiter und Blitzschutz. Auf den ersten Blick scheint es sich um dieselbe Technik zu handeln, doch sie unterscheiden sich deutlich in ihrer Funktion und dem damit einhergehenden technischen Umfang, wobei beide Komponenten für eine umfassenden Blitzschutz essenziell sind.
Ein Blitzableiter ist dabei für den äußeren Blitzschutz zuständig und wird direkt auf einem Gebäude installiert, um Blitzeinschläge abzufangen und den elektrischen Strom sicher in die Erde abzuleiten. Der Blitzschutz hingegen ist für den Überspannungsschutz verantwortlich. Er sorgt also dafür, dass sämtliche Anlagen im Haus nicht überspannt werden und verhindert dadurch sogenannte Überspannungsschäden an elektrischen Geräten und Anlagen.
Wie ist ein Blitzschutzsystem aufgebaut?
Eine Blitzschutzanlage besteht in der Regel aus einem inneren und äußeren Blitzschutz. Diese beiden Komponenten bestehen aus folgenden Bestandteilen:
äußerer Blitzschutz:
- Fangeinrichtung
- Ableitungen
- Erdungsanlage
innerer Blitzschutz:
- Überspannungsschutz
- Potentialausgleich
Wie funktioniert ein Blitzableiter?
- Blitz trifft auf Fangeinrichtung: Die Fangeinrichtung besteht aus einer Spitze oder Stange aus Metall, die auf dem Dach des Gebäudes montiert ist. Diese Spitze ist der höchste Punkt und zieht Blitze an, wenn ein Gewitter in der Nähe ist. Die negative Ladung des Blitzes wird dadurch positiv.
- Strom gelangt durch die Ableitungen: Die Ableitungen bestehen aus dicken Metallkabeln, die entlang der Außenwand des Gebäudes verlaufen und verhindern, dass der Blitz unkontrolliert durch das Gebäude fließt. Durch diese Kabel fließt der Strom nach unten.
- Blitzstrom gelangt in die Erdung: Am Boden angekommen, wird der Blitzstrom in die Erde geleitet, wo er sich schadensfrei entladen kann. Dafür gibt es Erdungsspieße oder Erdungsplatten, die tief im Boden vergraben sind und sich beim Einschlag negativ aufladen.
Was ist der Unterschied zwischen Fangstangen, Rohrfangstangen und Fangleitungen?
| Merkmal | Fangstangen | Rohrfangstangen | Fangleitungen |
| Konstruktion |
|
|
|
| Funktion |
|
|
|
| Einsatzgebiet |
|
|
|
| Vorteile |
|
|
|
| Nachteil |
|
|
|
Ist ein Blitzableiter Pflicht?
Für bestimmte Gebäudearten wie
- Schulen,
- Krankenhäuser oder
- andere öffentliche Einrichtungen
ist die Montage eines Blitzschutzsystems gesetzlich verpflichtend. Privathaushalte sind in der Regel davon befreit. Ob das für Sie persönlich zutrifft, hängt allerdings von der Region ab, in der Sie leben. In Gebieten, die als gefährdet gelten oder bei hohen und exponierten Gebäuden, kann ein Schutzanlage ebenfalls erforderlich sein. Darüber entscheiden zudem die baulichen Gegebenheiten und die Nutzung des Gebäudes.
In folgenden Fällen besteht ebenfalls eine Blitzschutz Pflicht:
- das Dach besteht aus brennbaren Materialien wie Holz oder Stroh
- die Gebäudehöhe von 20 Metern wird überschritten
- das Gebäude steht unter Denkmalschutz
- das Haus steht für sich allein auf einem Berg
Planen Sie einen Neubau oder das Nachrüsten, können Sie sich beim zuständigen Bauamt oder bei Ihrem Bauherren darüber informieren, ob die Integration einer Blitzschutzanlage erforderlich ist.
Darf ich einen Blitzableiter selbst installieren?
Grundsätzlich ist die Installation in Eigenregie aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen. Insbesondere dann nicht, wenn die Montage gesetzlich verpflichtend ist, denn dann muss diese von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Ein fehlerhafte Ausführung kann nicht nur wirkungslos sein, sondern sogar zusätzliche Gefahren verursachen.
Auch aus versicherungstechnischen Gründen sollten Sie sich am besten an einen Profi wenden. Denn ein vom Experten installierter Blitzschutz kann Ihre Gebäudeversicherungskosten senken, da einige Versicherungen Rabatte für Gebäude mit zertifiziertem Blitzschutz gewähren. Fragen Sie bei Ihrer Versicherung nach möglichen Einsparungen.
Wer installiert Blitzableiter?
Die Montage sollte grundsätzlich von Fachbetrieben durchgeführt werden, die sich auf Blitzschutz spezialisiert haben oder von Elektrofirmen mit entsprechender Zertifizierung. Diese Unternehmen verfügen über das nötige Know-how und die entsprechende Ausrüstung, um eine sichere und normgerechte Montage und somit einen umfassenden Schutz für Ihr Haus zu gewährleisten.
Ein Profi ist auch der richtige Ansprechpartner, wenn es um eine Risikobewertung des Gebäudes geht und Sie ein maßgeschneidertes Blitzschutzkonzept, das sowohl den äußeren als auch den inneren Blitzschutz umfasst, wünschen. Möchten Sie ein Blitzschutzsystem nachrüsten oder handelt es sich um eine Neuinstallation, sollten Sie im Vorfeld am besten mehrere Angebote miteinander vergleichen und sich dann für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis entscheiden.
Was kostet es, einen Blitzableiter zu installieren?
Die Gesamtkosten setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, zu denen neben den Materialkosten auch die Arbeitskosten für die fachgerechte Installation gehören. Möchten Sie eine innere sowie äußere Blitzschutzanlage installieren, sollten Sie mit Kosten zwischen 3.000 und 7.000 Euro rechnen. Eine Nachrüstung fällt in der Regel teurer aus als wenn Sie die Montage bereits bei der Planung Ihres Hausbaus berücksichtigen.
Bei der Auswahl des Blitzableitersystems sollten Sie zuerst verschiedene Anbieter vergleichen, da es Unterschiede in der Haltbarkeit und Wartungsanfälligkeit gibt. Ein qualitativ hochwertiges System kann in der Anschaffung teurer sein, bietet jedoch langfristig mehr Sicherheit und gegebenenfalls geringere Wartungskosten.
Welche Faktoren beeinflussen die Kosten einer Blitzableiter-Installation?
- Größe und Höhe des Gebäudes
- Anzahl der notwendigen Fangeinrichtungen
- Komplexität der Erdung
- Zustand des bestehenden Blitzschutzes (falls vorhanden)
- regionale und branchentypische Unterschiede bei den Handwerkerkosten
- Materialwahl
Was kostet ein Blitzableiter?
Wie hoch die Kosten für Sie persönlich ausfallen, hängt stark von den jeweiligen Gegebenheiten ab. Durchschnittlich sollten Sie nicht mehr als 3.000 Euro bezahlen, doch abhängig aller Eventualitäten wie individuellen Wünschen, den gegebenen Voraussetzungen kann die Installation in Einzelfällen auch bis zu 7.000 Euro kosten. Grundsätzlich gilt: Je komplexer die Montage ausfällt, desto weiter erhöht sich der Endpreis.
Installationskosten Blitzableitersystem
Durchschnittlich verdient ein Monteur, der für diese Arbeit zertifiziert ist, zwischen 50 und 80 Euro pro Stunde. Üblicherweise dauert die Montage ein bis zwei Tage. Gehen wir von einer Arbeitszeit von acht Stunden aus, ergeben sich die folgenden Beispielkosten:
| Dienstleistung | Kosten | Gesamtpreis |
| Stundenlohn | 65 Euro x 8 Stunden | 520 Euro pro Tag |
| An- und Abfahrt pauschal | 100 Euro | 100 Euro |
| Gesamt | 620 Euro |
Was kostet die Fangeinrichtung?
| Kostenfaktor | Preis |
| Fangstangen | 20 bis 90 Euro pro Stück |
| Rohrfangstangen | 30 bis 50 Euro pro Stück |
| Fangleitungen | 8 bis 15 Euro pro Meter |
| Verbindungsleitungen zum Erden | 10 bis 15 Euro pro Meter |
Was kostet die Erdung für ein Haus?
| Kostenfaktor | Preis |
| Erdungsanlage | 1.000 bis 3.000 Euro |
Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Kostenvergleich durchzuführen und somit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
Wie hoch sind die laufenden Kosten eines Blitzableiters?
Im Durchschnitt sollten Sie mit jährlichen Wartungskosten mit bis zu 300 Euro rechnen. Die Kosten setzen sich aus Wartungsarbeit und eventuellen Reparaturkosten zusammen. Diese Ausgaben sind essenziell, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen und eventuelle Verschleißerscheinungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Wie oft sollte eine Blitzableiter-Wartung durchgeführt werden?
Eine Wartung findet im Intervall von ein bis fünf Jahren statt, abhängig davon, ob es sich um ein öffentliches oder privates Gebäude handelt und wie hoch das Risiko eines Blitzeinschlags ist. Dabei werden alle Komponenten inspiziert, um sicherzustellen, dass diese im Ernstfall korrekt funktionieren. Sollte es zwischenzeitlich zu einem starken Blitzeinschlag kommen, kann auch eine zusätzliche Überprüfung notwendig und sinnvoll sein.
Welche DIN-Normen gelten für Blitzableitersysteme?
Die Installation und Wartung unterliegen in Deutschland strengen DIN-Normen, die sicherstellen, dass diese Schutzsysteme wirksam und sicher sind. Die zentralen Normen werden in der DIN EN 62305 geregelt:
DIN EN 62305-1: Allgemeine Grundsätze
Diese Norm beschreibt die grundlegenden Prinzipien des Blitzschutzes und die Eigenschaften von Blitzen. Sie dient als Einführung und legt die Basis für die weiteren Teile der Norm.
DIN EN 62305-2: Risikomanagement
Dieser Teil hilft bei der Bewertung des Risikos, das durch Blitze für ein Gebäude besteht. Hier wird bestimmt, ob ein Blitzschutzsystem notwendig ist und welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollten.
DIN EN 62305-3: Schutz von baulichen Anlagen
Diese Norm gibt detaillierte Anweisungen zur Planung und Installation, um physische Schäden an Gebäuden und Gefahren für Menschen zu vermeiden. Sie behandelt sowohl den äußeren Blitzschutz (Fangeinrichtungen, Ableitungen, Erdungen) als auch Maßnahmen zum Schutz vor Berührungs- und Schrittspannungen.
DIN EN 62305-4: Schutz von elektrischen und elektronischen Systemen
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Elektronik in Gebäuden beschreibt dieser Teil, wie man elektrische Systeme vor den Auswirkungen eines Blitzschlags schützt. Dazu gehören Maßnahmen wie der Einsatz von Überspannungsschutzgeräten und die Unterteilung von Gebäuden in Blitzschutz-Zonen.
Zusätzlich zu den DIN EN 62305-Normen gibt es die DIN EN 62561-Normenreihe, die die Anforderungen und Tests für die Komponenten eines Blitzschutzsystems beschreibt, wie zum Beispiel die Verbindungen, Erdungsstäbe und Funkenstrecken.
Wie beeinflusst die DIN-Norm die Kosten?
Diese Normen legen detaillierte Anforderungen und Standards für die Planung, Montage und Wartung von Blitzschutzsystemen fest, wodurch folgende Kostenfaktoren beeinflusst werden:
- Qualität der Materialien: Die DIN-Normen schreiben vor, welche Materialien verwendet werden dürfen und wie diese zu verbauen sind.
Folge: Hochwertige Materialien, die den Normen entsprechen, sind oft teurer. - Fachgerechte Installation: Die Normen verlangen, dass das System von qualifizierten Fachleuten installiert wird. Dies schließt eine fachgerechte Planung, den Einsatz spezieller Werkzeuge und die Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften ein.
Folge: Steigende Arbeitskosten, durch Inanspruchnahme zertifizierter Betriebe und Fachkräfte. - Notwendige Prüfungen und Zertifizierungen: Die DIN-Normen sehen regelmäßige Inspektionen und Prüfungen vor, um die Funktionsfähigkeit des Blitzschutzsystems zu gewährleisten.
Folge: Prüfungen durch qualifiziertes Fachpersonal. - Komplexität der Installation: Je nach Gebäudeart und Risikoanalyse (ebenfalls durch die Normen geregelt) kann der Installationsaufwand steigen.
Folge: Umfangreiche Schutzmaßnahmen, die den Gesamtaufwand und damit auch die Kosten erhöhen.
Vorteile und Nachteile eines Blitzableitersystems
| Vorteile | Nachteile |
|
|
Diese fünf Dinge sollten Sie beachten
- Einbeziehung der gesamten Gebäudehöhe: Bei der Planung muss die gesamte Gebäudehöhe berücksichtigt werden, wozu auch Dachaufbauten wie Antennen oder Schornsteinen zählen. Diese können als besonders blitzgefährdet gelten und erfordern zusätzliche Schutzmaßnahmen.
- Korrosionsschutz der Materialien: Alle verwendeten Materialien müssen korrosionsbeständig sein, besonders in feuchten oder salzhaltigen Umgebungen. Korrosion kann die Wirksamkeit beeinträchtigen und zu teuren Reparaturen führen.
- Erreichbarkeit für Wartungsarbeiten: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten leicht zugänglich sind, um regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten durchführen zu können. Eine schlechte Erreichbarkeit kann die Wartung erschweren und die Sicherheit beeinträchtigen und die Kosten erhöhen.
- Anpassung an bestehende Gebäudestrukturen: Die Blitzableiteranlage sollte im Idealfall ohne bauliche Veränderungen installiert werden können, um die Installationskosten so niedrig wie möglich zu halten.
- Berücksichtigung lokaler Wetterbedingungen: Die Planung sollte die spezifischen Wetterbedingungen in Ihrer Region berücksichtigen, insbesondere die Häufigkeit und Intensität von Gewittern.
Fazit
Eine Blitzschutzanlage bietet einen effektiven Schutz gegen die gefährlichen Folgen eines Blitzeinschlags. Die Installation erfordert zwar eine Investition, aber der Schutz von Gebäuden, Bewohnern und elektrischen Geräten rechtfertigt diese Kosten. Es wird dabei zwischen einem inneren und einem äußeren Blitzschutz unterschieden. Während der äußere Blitzableiter das äußere eines Gebäudes schützt, ist das innere System für den Überspannungsschutz im Gebäudeinnere verantwortlich. Regelmäßige Wartung und fachgerechte Ausführung ist essenziell, um die volle Funktionalität des Blitzschutzsystems sicherzustellen. Insgesamt bietet eine Blitzschutzanlage nicht nur Sicherheit, sondern kann auch langfristige Schäden und Kosten verhindern.
Blitzableiter installieren: Häufig gestellte Fragen
Wie lange hält ein Blitzableiter?
Im Schnitt liegt die Lebensdauer zwischen 4 und 7 Jahren, wobei Ihr Ableiter bei regelmäßiger Wartung und Pflege auch mehrere Jahrzehnte funktionsfähig bleiben kann. Verschleißteile wie Ableitungen und Erdungen sollten daher in einem festgelegten Intervall überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Was ist der Unterschied zwischen äußerem und innerem Blitzschutz?
Der äußere Blitzschutz fängt den Blitz ab und leitet ihn sicher in die Erde ab, während der innere Blitzschutz vor Überspannungsschäden an elektrischen Geräten und Anlagen im Gebäude schützt.
Kann ein Blitzableitersystem auch nachträglich installiert werden?
Ja, eine Montage kann auch nachträglich an einem bestehenden Gebäude installiert werden. Die Kosten und der Aufwand hängen jedoch von der Bauweise und den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab. Meistens ist das Nachrüsten mit einem höheren Arbeitsaufwand und ist damit auch teurer. Planen Sie ein solches System am besten beim Hausbau bereits mit ein.