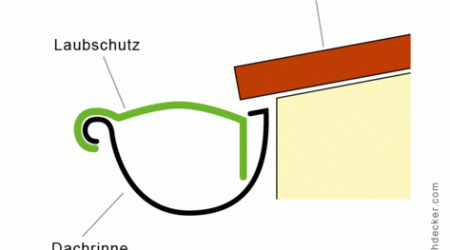Aufgrund des geringen Neigungswinkels ist bei einem Flachdach damit zu rechnen, dass sich Pfützen bilden können. Dies wiederum kann dafür sorgen, dass das Wasser auf der Fläche des Daches verbleibt, wodurch Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt und sogar Schimmel entstehen kann. Deshalb ist die optimale Flachdachentwässerung essenziell. Doch wie funktioniert die Dachentwässerung bei dieser Dachart eigentlich und welche gesetzlichen Regelungen sind dabei einzuhalten?
- Was ist eine Flachdachentwässerung?
- Freispiegelentwässerung
- Druckstromentwässerung
- Gründächer als Dachentwässerung
- Notentwässerung: Was ist das und wann kann auf eine Notentwässerung verzichtet werden?
- Wie funktioniert eine Dachentwässerung am Flachdach?
- Welche gesetzlichen Vorschriften müssen bei der Dachentwässerung eingehalten werden?
- Flachdachentwässerung Kosten
- Fazit
Alles auf einen Blick:
- Aufgrund der geringen Dachneigung muss für das Flachdach eine besonders effektive Entwässerung eingebaut werden.
- Die Regelungen hierzu ergeben sich aus der DIN EN 12056.
- Unterscheiden lassen sich unter anderem die Freispiegelentwässerung und die Druckstromentwässerung.
- Auch auf eine Notentwässerung ist zu achten, da das Dach einen Notüberlauf benötigt, falls der reguläre Dachablauf beispielsweise verstopft oder überfordert ist.
- Die Dachentwässerung kann in Form einer Dachrinne oder als innenliegende Variante eingebaut werden.
Was ist eine Flachdachentwässerung?
Im Gegensatz zu einem klassischen Dach hat das Flachdach den Nachteil einer sehr geringen Neigung. Das bedeutet, dass Regen- und Schmelzwasser nur schwer ablaufen, gerade wenn diese in großen Mengen und in kurzer Zeit auf das Dach treffen. Durch diese zusätzlichen Lasten auf der Fläche wäre die Statik des Hauses jedoch gefährdet und außerdem könnte die Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen, wenn sie nicht umgehend abgeleitet werden würde. Zu diesem Zwecke wird ein umfangreiches Entwässerungssystem inklusive Notüberlauf eingebaut.
In Deutschland gilt die Flachdachrichtlinie. die unter anderem regelt, wie Pfützenbildung durch Gefälle vermieden wird.
Welche Arten der Entwässerung gibt es für Flachdächer?
Bei der Flachdachentwässerung unterscheidet man grundsätzlich zwischen der einfachen Entwässerung und der Notentwässerung. Die einfache Flachdachentwässerung lässt sich wiederum in zwei Varianten unterteilen, und zwar in die Freispiegelentwässerung und in die Druckstromentwässerung.
Freispiegelentwässerung
Freispiegelentwässerung bedeutet, dass das Wasser mehrere Fallrohre passiert, ehe es in einer Grundleitung landet, die für die Ableitung des Wassers sorgt. Die Schwerkraft sorgt bei diesem System also dafür, dass das Regenwasser schnellstmöglich abgeleitet wird.
Wie schnell das Wasser abfließen kann, richtet sich vor allem nach dem Gefälle der Rohre und nach der Größe und Form des Dachablaufs.
Entsprechende Regelungen zu dieser Art der Dachentwässerung ergeben sich aus der DIN EN 12056-3 Abs. 6.1 und aus der DIN 1986-100:2016-12 Abs. 14.2.7.
Vor- und Nachteile auf einen Blick
| Vorteile | Nachteile |
|
|
Anwendungsfälle
Diese Variante ist die klassische Form, die immer angewendet wird, wenn normale Dachrinnen und Fallrohre aus optischen Gründen kein Problem darstellen.
Druckstromentwässerung
Die Regelungen zur Druckstromentwässerung ergeben sich aus der DIN 1986-100:2016-12 Abs. 14.3. Bei diesem System werden Anschlussleitungen unter der Dachkonstruktion installiert. Die verschiedenen Ablaufströme gelangen zuerst in die Anschlussleitung und dann in die gemeinsame Fallleitung. In der Sammelleitung entsteht ein Unterdruck, wodurch eine hohe Fließgeschwindigkeit erreicht werden kann, sodass die Dachentwässerung innerhalb kurzer Zeit zuverlässig erfolgt.
Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Leitungen, die unter dem Dach installiert werden, keine Neigung benötigen. Dies ist dem Unterdruck zu verdanken. Außerdem ist kaum ein Wartungsaufwand notwendig und die Rohre reinigen sich durch den Unterdruck von selbst.
Vor- und Nachteile auf einen Blick
| Vorteile | Nachteile |
| vergleichsweise teuerentsprechende Druckstromanlage muss installiert werdenStörungen der Anlage möglich |
Anwendungsfälle
Diese Variante wird gewählt, wenn die Dachentwässerung optisch nicht auffallen soll. Die Rohre werden in das Gebäude integriert und sind von außen nicht sichtbar, da es sich um eine innenliegende Entwässerung handelt.
Gründächer als Dachentwässerung
Eine Begrünung der Dächer sorgt nicht nur für Wohlbefinden und trägt zum Umwelt- und Artenschutz bei. Das Gründach stellt zudem eine spezielle Form der Flachdachentwässerung dar. Zu unterscheiden ist hier zwischen der intensiven und der extensiven Dachbegrünung. Die extensive Begrünung besteht aus Bodendeckern und ist vergleichsweise leicht, während bei der intensiven Begrünung sogar Bäume auf dem Dach gepflanzt werden können, wenn es die Statik des Hauses zulässt.
Der Vorteil einer Dachbegrünung besteht darin, dass das Niederschlagswasser nicht in großen Mengen vom Dach abgeleitet werden muss, da es im Boden versickert. Dies wiederum freut die Pflanzen, die das Regenwasser benötigen, um wachsen zu können. Das aufgenommene Regenwasser kann zudem verdunsten. Dies wirkt gleichzeitig einer Überhitzung der Umgebung entgegen. Außerdem muss kein Wasser in den Kanal eingeleitet werden, was das öffentliche Netz entlastet.
Vor- und Nachteile auf einen Blick
| Vorteile | Nachteile |
|
|
Anwendungsfälle
Begrünte Dächer empfehlen sich vor allem für Häuser, die in Städten stehen, in denen es kaum Grünanlagen gibt. Sie sind ökologisch wertvoll, denn sie tragen zum Umwelt- und Artenschutz bei.
Notentwässerung: Was ist das und wann kann auf eine Notentwässerung verzichtet werden?
Neben den beiden oben genannten Standard-Varianten muss bei einem Flachdach mit geringer Neigung immer eine Notentwässerung vorhanden sein. Dieser Notüberlauf beziehungsweise der Notablauf kommt zum Einsatz, wenn das Regenwasser aus irgendwelchen Gründen nicht über die normale Entwässerung aufgenommen werden kann. Das ist beispielsweise bei extremem Starkregen der Fall.
Die Richtlinien zur Notentwässerung gehen aus der DIN 1986-100:2016-12 Abs. 5.9 hervor.
Die Notentwässerung beinhaltet einen separaten Ablauf oder einen sogenannten Attika-Ablauf, der frei auf dem Grundstück enden muss. Es ist also nicht erlaubt, die Notentwässerung an einen Kanal anzuschließen.
Vor- und Nachteile auf einen Blick
| Vorteile | Nachteile |
|
|
Anwendungsfälle
Die Notentwässerung in Form eines Notablaufs beziehungsweise eines Notüberlaufs ist bei allen Flachdächern mit geringem Neigungswinkel vorgeschrieben.
Es gibt Ausnahmefälle, unter denen keine Notentwässerung eingebaut werden muss. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Regenrückhaltung auf der Dachfläche erfolgt.
Wie funktioniert eine Dachentwässerung am Flachdach?
Wie die Dachentwässerung beim Flachdach funktioniert, hängt von der jeweiligen Variante ab. Die Freispiegelentwässerung funktioniert allein durch die Schwerkraft, denn die anfallenden Wassermengen werden durch Fallrohre abgeleitet.
Bei der Druckstromentwässerung erfolgt die Entwässerung am Flachdach durch einen Unterdruck, der durch ein spezielles Gerät erzeugt wird.
Wie wird ein Flachdach entwässert?
Ein Flachdach wird grundsätzlich durch eine Kombination aus Abläufen und Rohrleitungen entwässert. Wie diese angeordnet sind, wie viele Abläufe notwendig sind und wie die Entwässerung im Einzelnen funktioniert, hängt jedoch von der gewählten Entwässerungsvariante ab.
Berechnung: Wie viele Abläufe braucht ein Flachdach?
Wie viele Dachabläufe benötigt werden, richtet sich nach unterschiedlichen Faktoren. Die genaue Anzahl kann durch eine Berechnung mit der folgenden Formel ermittelt werden:
Regenfluss der gewünschten Dachfläche (l/s) : Ablaufvermögen des Dachablaufs (l/s)
= Anzahl der benötigten Abläufe
Grundsätzlich lässt sich jedoch für die Berechnung festhalten: Je größer die Dachfläche und je geringer die Dachneigung, desto mehr Abläufe werden benötigt. Für die Konzeption des Dachs mit zuverlässiger Entwässerung ist es sinnvoll, die Beratung durch einen Architekten oder einen professionellen Dachdecker in Anspruch zu nehmen. Dieser kann in seiner Planung auch die Berechnung der benötigten Dachabläufe für Sie vornehmen.
Welche gesetzlichen Vorschriften müssen bei der Dachentwässerung eingehalten werden?
Damit das Flachdach zuverlässig entwässert werden kann und hierdurch Schäden vermieden werden, müssen verschiedene Richtlinien eingehalten werden. Diese Richtlinien ergeben sich in der Regel aus den geltenden DIN-Normen. Hierzu gehört beispielsweise die DIN EN 12056.
Welche Vorschriften gibt es für die Flachdachentwässerung?
Wir möchten Ihnen nachfolgend die wichtigsten Vorschriften für die Flachdachentwässerung und die Notenwässerung vom Flachdach vorstellen.
Für Entwässerungssysteme ist vor allem die DIN EN 12056 wichtig, die europaweit gilt. Für Deutschland greift außerdem die DIN 1986-100. Beide Normen regeln identische Inhalte, und zwar:
- Die Flachdachentwässerung ist so zu planen, dass der Niederschlag auf dem kürzesten Weg von der Dachfläche ablaufen kann.
- Verfügt das Dach nicht über ein ausreichendes Gefälle, muss eine Notentwässerung installiert werden.
- Alle Abflussleitungen, Dachabläufe und Rohrsysteme müssen frei zugänglich sein, um Wartungsarbeiten problemlos vornehmen zu können.
- Bei innenliegenden Abläufen sind separate Notabläufe einzuplanen, durch die überschüssiges Regenwasser schnell abgeleitet werden kann.
Flachdachentwässerung Kosten
Für die Flachdachentwässerung fallen selbstverständlich entsprechende Kosten an, die je nach Art der Entwässerung variieren können. Mit Abstand am teuersten ist das Gründach, das jedoch staatlich gefördert wird.
Was kostet eine Flachdachentwässerung?
Ein einfaches Entwässerungssystem mit außenliegenden Rohren kostet etwa 50 Euro pro Meter. Hinzu kommen die Kosten für die Abläufe in Form von Gullys. Inklusive Einbau müssen Sie hier je nach Modell zwischen 150 und 300 Euro einplanen.
Entscheiden Sie sich für eine Dachbegrünung inklusive natürlicher Dämmung, sollten Sie hier für eine einfache Variante zwischen 80 und 120 Euro pro Quadratmeter einplanen. Bei großen Dachflächen können begrünte Dächer aber auch deutlich teurer ausfallen. Es besteht aber beispielsweise die Möglichkeit, einen Zuschuss vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Höhe von 15 Prozent der förderfähigen Kosten für eine Dachsanierung zu erhalten. Außerdem gibt es von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Förderkredit mit Tilgungszuschuss für eine Sanierung zum Effizienzhaus. Zu den förderfähigen Kosten gehören hierbei im Zuge von Dacharbeiten auch ein Dachaufbau mit Begrünung.
Fazit
Ein effektives Entwässerungssystem ist wichtig, damit Niederschlagswasser umgehend abgeleitet werden kann. Andernfalls kann es zu Schäden am Gebäude und zur Schimmelbildung kommen. Die Flachdachentwässerung kann entweder klassisch durch Dachrinnen erfolgen oder es wird eine „unsichtbare“ Variante mit innenliegenden Rohren verwendet. In diesem Fall wird das Regenwasser mit Druckluft abgeleitet. Außerdem ist meistens eine sogenannte Notentwässerung notwendig. Weitere Informationen zur Flachdach-Entwässerung können Sie durch eine Beratung vom Profi erhalten.